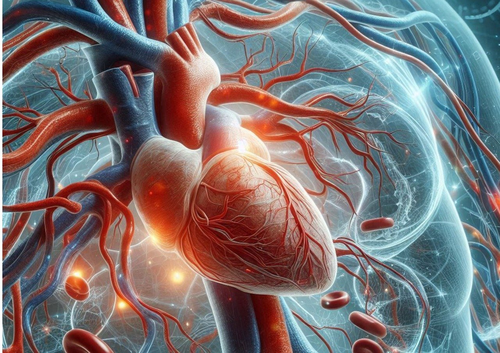Am Universitätsklinikum Ulm (UKU) bietet das Universitäre Herzzentrum Ulm Tumorpatient*innen bei einer potenziell kardiotoxischen Chemotherapie eine wichtige Anlaufstelle: das Zentrum für Onkologische Kardiologie. Um mögliche herzschädigende Effekte sofort zu erkennen und nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu behandeln, erhalten die Patient*innen hier während ihrer Tumortherapie eine sorgfältige, kardiologische Begleitung.
Moderne onkologische Therapieverfahren können Tumoren in vielen Fällen erfolgreich bekämpfen. Im Rahmen unerwünschter Nebenwirkungen schädigen sie jedoch nicht selten den Herzmuskel (Kardiotoxizität) und können somit langfristig eine schwere Herzschwäche verursachen. Dies gilt für Erwachsene, aber insbesondere auch für Kinder mit bösartigen Erkrankungen. Um frühzeitig herzschädigende Auswirkungen der Tumortherapie zu erkennen und unter Umständen durch vorbeugende Therapien zu verhindern, bedarf es vor, während und nach der Tumortherapie einer genauen Überwachung und Betreuung durch spezialisierte Kardiolog*innen.
Durch die enge Zusammenarbeit mit den onkologischen Fachbereichen des Universitätsklinikums Ulm sowie den umliegenden Kliniken und onkologischen Einrichtungen, trägt das Herzzentrum Ulm dazu bei, individuelle und herzschonende Behandlungskonzepte zu definieren und somit zu einem bestmöglichen Behandlungsergebnis zu kommen. Neben der klinischen Versorgung kardio-onkologischer Patient*innen liegt ein weiterer Schwerpunkt des Zentrums in der Erarbeitung fundierter klinisch-wissenschaftlicher und grundlagenwissenschaftlicher Erkenntnisse auf dem Gebiet der onkologischen Kardiologie.
So konnte zum Beispiel in einer aktuellen Studie unter der Leitung von Prof. Dr. Dominik Buckert, Stellvertretender Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin II am UKU, in Zusammenarbeit mit der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe herzschädigende Effekte der Tumortherapie bei Patientinnen mit Brustkrebs untersucht werden. Die Ergebnisse der Studie wurden im International Journal of Cardiovascular Imaging veröffentlicht: Mit Hilfe fortgeschrittener Verfahren zur Gewebecharakterisierung in der Kardio-MRT-Bildgebung konnte bei den Studienteilnehmerinnen gezeigt werden, dass es in Abhängigkeit von den eingesetzten onkologischen Therapien zur Ausbildung eines Myokardschadens kommt, der in der klassischen kardiologischen Diagnostik verborgen geblieben wäre.
„Die Ergebnisse verdeutlichen die Notwendigkeit, Krebspatienten und -patientinnen auch aus kardiologischer Sicht zu betrachten – nur so können möglicherweise prognoserelevante Folgeschäden frühzeitig erkannt werden“, so Dr. Johannes Kersten, Arzt in der kardiologischen Gemeinschaftspraxis Herzplus und Erstautor der Studie, die während seiner Facharztweiterbildung zum Kardiologen in der Klinik für Innere Medizin II entstand. Prof. Dr. Dominik Buckert, Verantwortlicher für den Bereich Onkologische Kardiologie und Letztautor, ergänzt: „Darüber hinaus sehen wir darin das Potenzial, Risikopatienten und -patientinnen frühzeitig mit einer modernen Herzinsuffizienztherapie zu begleiten, um schädigende Effekte abzumildern oder sogar zu verhindern. Sicher ist, dass dieser Bereich in den nächsten Jahren deutlich an Bedeutung gewinnen wird.“ Besonderes Augenmerk liegt dabei auch auf der Betreuung von Kindern mit bösartigen Erkrankungen. Trotz fortschrittlicher Therapiemöglichkeiten und teilweiser sehr guter Heilungschancen der Krebserkrankung, können einzelne Patient*innen im weiteren Verlauf auch im fortgeschrittenen (Erwachsenen-) Alter noch eine durch die Krebstherapie erlittene Herzschädigung aufweisen. Dazu zählt z.B. die Entwicklung einer Herzinsuffizienz. Aber auch das Risiko für eine koronare Herzerkrankung, also verkalkte Herzkranzgefäße, oder einen Schlaganfall ist bei Überlebenden einer Krebserkrankung im Kindesalter etwa um das 10-fache erhöht. Umso wichtiger wird die lebenslange strukturierte Nachsorge dieser Patient*innen und eine geordnete Transition von der kinderkardiologischen zur erwachsenenkardiologischen Nachsorge. Aktuell übliche Nachsorgeintervalle enden in der Regel nach 10 Jahren.
„Um dem entgegenzuwirken und die Versorgung der Patientinnen und Patienten nachhaltig zu verbessern, haben wir auf dieses alarmierende Problem auch in einem Konsensuspapier der deutschen Fachgesellschaften für Kardiologie, Pädiatrische Kardiologie sowie Pädiatrische Hämatologie und Onkologie hingewiesen“, so Prof. Dr. Christian Apitz, Leiter der Sektion Pädiatrische Kardiologie am UKU. Die Kooperation unter dem Dach des Universitären Herzzentrums ist dabei ein wichtiger Meilenstein und ermöglicht nun die Möglichkeit, die kardiologische Nachsorge und Betreuung von Kindern und Jugendlichen strukturiert und wissenschaftlich begleitet zu gewährleisten.